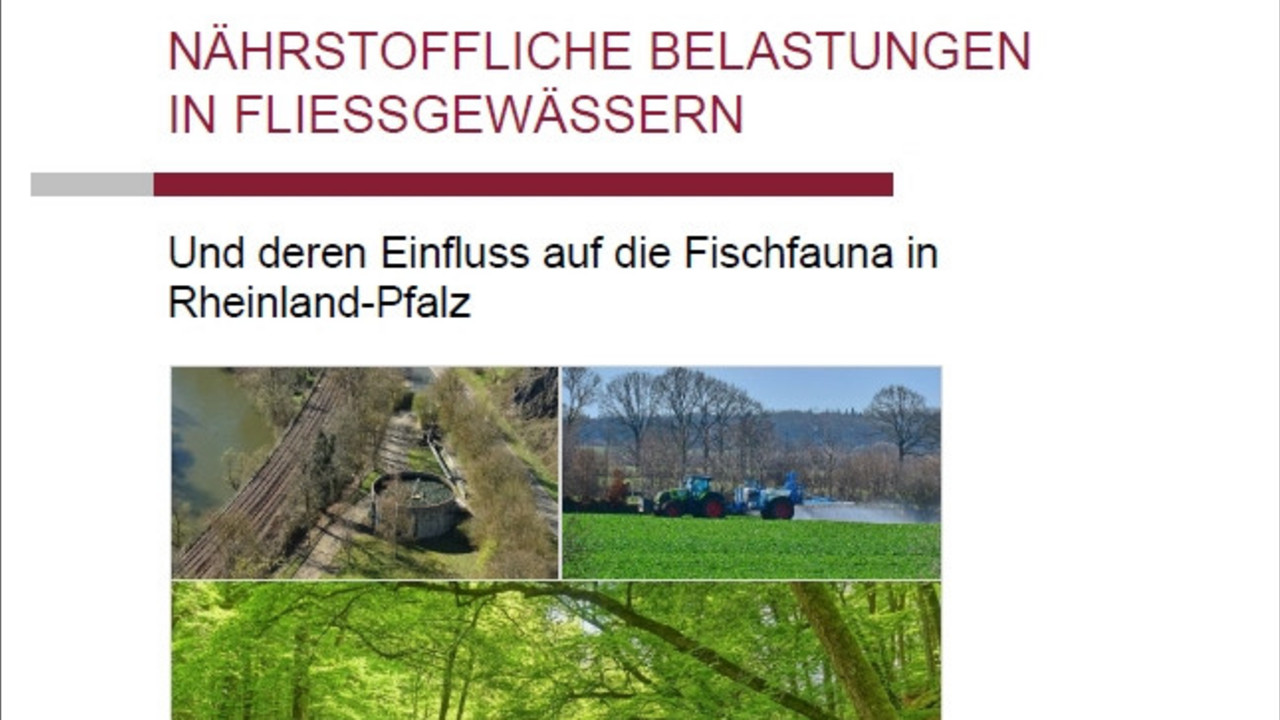Zum LfU-Bericht: Nährstoffliche Belastungen in Fließgewässern und deren Einfluss auf die Fischfauna in Rheinland-Pfalz
Die wesentlichen Ergebnisse:
- Nährstoffe haben für die Ökologie von Fischen und ihren Lebensgemeinschaften eine grundlegende Bedeutung. In dieser Studie wird der Frage nachgegangen, welchen Einfluss Nährstoffe auf das Vorkommen von Fischen und den fischökologischen Zustand in Fließgewässern in Rheinland-Pfalz haben. Hierzu werden die Daten aus dem biologi-schen und chemischen Monitoring von 2017 bis 2019 statistisch ausgewertet. Die Daten umfassen (i) die allgemein physikalisch-chemischen Parametern, (ii) die Saprobienindices des Makrozoobenthos und (iii) die fischbiologischen Erhebungen.
- Nährstoffliche Belastungen in Fließgewässern sind in Rheinland-Pfalz noch verbreitet. Schwerpunkte der Belastung liegen großräumig in der Oberrheinebene und betreffen andernorts einzelne Gewässer, wie Nothbach, Lauter und Wiesbach. Neben den Dauerbelastungen sind in einigen Bächen auch spitzenartige Belastungen auffällig.
- In Bächen erweisen sich insbesondere hohe Konzentrationen von Ammonium und Nitrit als beeinträchtigend für die Fischfauna aus. In der Unteren Forellenregion und der Äschenregion beeinflusst zudem die organische Belastung bzw. die Saprobie den fisch-ökologischen Zustand. Die regulativen Grenzwerte für die Saprobie sind deutlich zu hoch, um die Belastung in der Forellenregion abzubilden. Die Vielfalt der stofflichen Belastungen ist in der Äschenregion am höchsten. Die absoluten Mengen der stofflichen Belastungen sind in der Cyprinidenregion am höchsten, da diese überwiegend in der Oberrheinebene vorkommt.
- Erhöhte Konzentrationen von Gesamtphosphat und Orthophosphat sind weit verbreitet. Der Einfluss von hohen Phosphatgehalten auf die fischbiologische Zustandsbewertung ist deswegen schwierig statistisch nachweisbar. Die realisierte Eutrophierung aufgrund hoher Phosphorkonzentrationen betrifft in der Barbenregion die meisten Gewässer, sie kann jedoch bereits auch in der Forellen- und Äschenregion im Einzelfall den fischökologischen Zustand beeinflussen.
- Die Besiedlungsdichten von Fischarten korrelieren mit Nährstoffgehalten und der Intensität des Stoffumsatzes. Die Dichten der Bachforelle, nachfolgend von der Groppe sind von allen Fischarten am häufigsten und ausschließlich negativ mit Nährstoffgehalten korreliert. Die Dichten beider Arten korrelieren auch negativ mit der Saprobie, während die Dichten von Döbel, Gründling, Dreistachliger Stichling, Bachschmerle und Plötze positiv mit der Saprobie korrelieren. Zudem steigen die Dichten vom Döbel mit der Eutrophierung und die vom Dreistachligen Stichling mit den Konzentrationen von Ammonium und Nitrit.
- Die Gesamtbewertung des ökologischen Zustands der Wasserkörper korrespondiert mit der Landnutzung. Die Flächenanteile von Acker, Siedlungen und Sonderkulturen korrelieren mit den stofflichen Belastungen. Ab einem Ackeranteil von über 20 % wird in der oberen Forellenregion ein guter Zustand unwahrscheinlich. Der Einfluss der Flächennutzung auf Stoffkonzentrationen variiert je nach Fischregion bzw. Gewässergröße und Lage. Die Stoffeinträge aus Punktquellen scheinen in der Unteren Forellenregion am einflussreichsten für den fischökologischen Zustand zu sein.
- Die hier ermittelten Wirkungen von Stoffen auf die Fischfauna belegen die Notwendigkeit einer guten Wasserqualität für die Zielerreichung eines guten fischökologischen Zustands. Eine geringe nährstoffliche Belastung ist insbesondere für gute Bestände der Bachforelle und der Groppe wichtig bzw. der Zielerreichung in Forellen- und Äschenbächen in Rheinland-Pfalz.
- Fallstudie Nister: Die stoffliche Belastung an der Unteren Nister ist seit 1990 deutlich geringer geworden. Dennoch entwickeln sich im Frühjahr massenhaft fädige Algen auf der Sohle. Die Fischfauna hat sich u.a. durch eine deutliche Zunahme der Elritze sowie durch die Abnahmen von Aal und Äsche sowie auch anderer Arten wie der Nase verändert. Das Ablussregime hat sich ab den 1990-Jahren und noch verstärkt seit 2008 dramatisch verändert, mit erheblich geringeren Abflüssen, insbesondere von April bis September. Die jahreszeitlichen Beziehungen von Orthophosphat zu Wassertemperatur und Abfluss weisen darauf hin, dass die starke Zunahme der Konzentration von Orthophosphat im Frühjahr wahrscheinlich grundlegend für die Eutrophierungsprozesse ist.
- Schutzmaßnahmen zur Verminderung von Nährstoffeinträgen sind äußerst wichtig. Zu diesen zählen Gewässerrandstreifen bei belastenden diffusen Einträgen. Wirksame Randstreifen erstrecken sich über längere Fließstrecken, sind zusammenhängend, dauerhaft angelegt, funktional strukturiert und hinreichend breit. Für den Stoffeintrag aus Kläranlagen an Bächen ist eine Immissionsbetrachtung erforderlich, die sich auf einen ökologisch relevanten Bemessungsabfluss bezieht. Dieser berücksichtigt die aktuellen klimatischen Veränderungen.